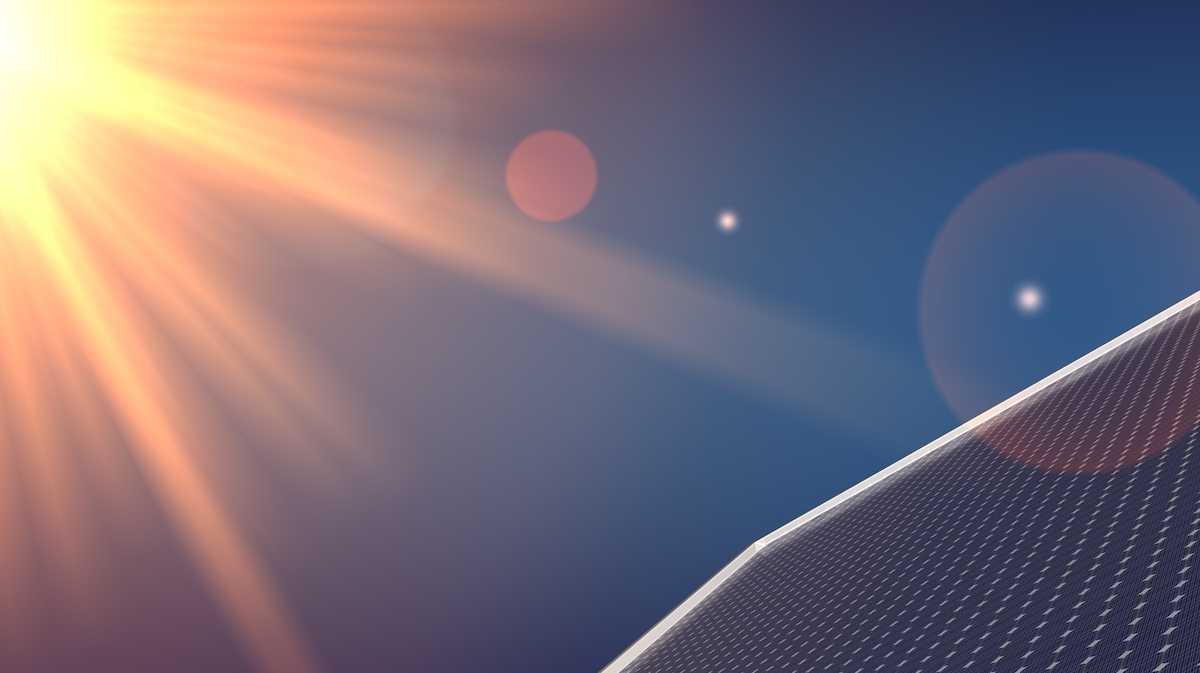Solarstrom
Photovoltaikanlage: Nutzen, Kosten und Steuern
Photovoltaikanlagen boomen. Dafür sorgten zuletzt Lockerungen im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Statt teure Strompreise beim Versorger zu bezahlen, produzieren viele Bewohner ihren Strom lieber selbst. Wie das gelingt und für wen sich die Installation einer solchen Solaranlage lohnt. Ein Überblick und Update 2025.

Um es gleich vorwegzunehmen: Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) eignen sich für jeden Haushalt. Vor allem, wenn der Stromverbrauch hoch ist und dieser an die Produktionszeiten der Anlage angepasst werden kann. Selbst verbrauchen ist derzeit günstiger als einspeisen. Denn die Einspeisevergütung liegt deutlich unter dem aktuellen Strompreis. Größere Anlagen sind zudem finanziell attraktiver als kleinere.
Was sind Photovoltaikanlagen?
Photovoltaikanlagen bestehen im Kern aus Solarzellen, deren Halbleiter bei Sonnenlicht Elektronen bewegen und auf diese Weise Strom erzeugen. Der produzierte Gleichstrom wird über einen Wechselrichter in Haushaltsstrom umgewandelt.

Die Photovoltaikanlagen auf dem Hausdach kann zur Eigennutzung oder Netzeinspeisung von Strom dienen.
Um die kostenlose Sonnenenergie zu nutzen, können Sie eine Photovoltaikanlage auf dem Dach errichten oder Solarmodule auf dem Balkon oder der Terrasse installieren.
Ein Zähler zeigt an, wann wieviel Strom erzeugt wird. Ein optionaler Stromspeicher sorgt dafür, dass der tagsüber erzeugte Solarstrom auch nachts sowie an dunklen Tagen genutzt werden kann. Überschüssigen Strom, der nicht für den eigenen Haushalt benötigt wird, können Sie ins öffentliche Stromnetz einspeisen.
Basierend auf der gleichen Technologie werden vier Typen von Photovoltaikanlagen unterschieden:
1Inselanlagen
Wer keinen direkten Zugang zum Stromnetz hat (zum Beispiel Tiny Houses, freistehende Garagen oder Gartenlauben), kann eine Inselanlage installieren. Der produzierte Strom muss allerdings direkt verbraucht oder mit einer Batterie zwischengespeichert werden.
2Anlagen mit vollständiger Netzeinspeisung
Bei den so genannten „netzparallelen Anlagen“ wird der erzeugte Strom vollständig in das öffentliche Netz gespeist. Im Unterschied zur Überschusseinspeisung, bei der nur der nicht genutzte Strom abgegeben wird. Für die Einspeisung erhalten Photovoltaikanlagen-Besitzer eine Vergütung. Sie ist unter anderem abhängig von der Leistung und dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme und ändert sich monatlich.
3Anlagen zur teilweisen Eigennutzung mit oder ohne Speicher
Bei dieser Variante wird ein Teil des erzeugten Solarstroms selbst genutzt, der Rest wird in das Stromnetz eingespeist. Wieviel Strom selbst verbraucht wird, hängt davon ab, zu welchen Zeiten Ihre Elektrogeräte betrieben werden. Bei Anlagen ohne Batteriespeicher sind etwa 30 Prozent Eigenverbrauch realistisch. Dieser lässt sich etwas steigern, indem der Betrieb von Stromfressern wie Waschmaschine, Geschirrspüler und Backofen in den Hochphasen der Photovoltaikanlage erfolgt. Mit einem Batteriespeicher können Sie den Eigenverbrauchsanteil auf bis zu 70 Prozent erhöhen. Der Speicher bewahrt die produzierte Energie für Zeiten auf, in der die PV-Anlage keinen Strom liefert (zum Beispiel nachts). Allerdings sind Stromspeicher noch recht teuer und bei vielen Speichermodulen müssen Sie derzeit mit längeren Lieferzeiten rechnen.
4Stecker-Photovoltaik-Geräte
Auch kleine Stecker-Photovoltaik-Geräte wandeln Sonnenlicht in Strom um. Der Strom aus so einem Stecker-Solargerät wird über eine Steckdose in das Wohnungsnetz eingespeist und dort genutzt. Hierfür benötigen Sie eine spezielle Energiesteckdose. Auch wenn sie weniger Ertrag als eine PV-Anlage auf dem Dach bringen: Die Module sind insbesondere für Mieter und Wohnungen attraktiv, die einen nach Süden ausgerichteten Balkon oder eine Terrasse haben. Laut dem Bundesverband der Verbraucherzentralen und ihren regionalen Vertretungen liefert ein 300-Watt-Solarmodul, das verschattungsfrei an einem Südbalkon montiert wurde, etwa 200 Kilowattstunden Strom pro Jahr. Bei einer Laufzeit von 20 Jahren sind das 4.000 Kilowattstunden Strom.
Balkon Solaranlage
Schnell und günstig zum eigenen Strom: So funktioniert eine Solaranlage auf dem Balkon
Was kostet die Solaranlage? Sofort Angebot ermitteln!
Für wen lohnt sich die Photovoltaikanlage?
Gestiegene Strompreise, Klimaschutz, hoher Stromverbrauch, Autarkie: Es gibt mehrere Gründe, warum eine Photovoltaikanlage sinnvoll ist. Der selbst erzeugte Strom ist auf lange Sicht die preisgünstigste und umweltschonendste Variante, da für die Erzeugung regenerative Sonnenenergie eingesetzt wird.
Ob sich die zum Teil hohe Anfangsinvestition lohnt, hängt von mehreren Faktoren ab:
- der Leistung und dem Ertrag der PV-Anlage (u. a. abhängig von der Größe und dem Installationsort),
- dem eigenen Stromverbrauch,
- den zukünftigen Stromkosten,
- den Tageszeiten, an denen viel Strom benötigt wird, und
- der Entscheidung, ob der Strom vollständig ins Stromnetz eingespeist oder auch selbst genutzt wird.
- Darüber hinaus helfen Förderprogramme, die Kosten zu senken.
Verbraucht Ihr Haushalt viel Strom, benötigen Sie mehrere Solarmodule beziehungsweise eine höhere Stromleistung der Photovoltaikanlage. Möglichst viel Strom selbst nutzen können Sie, wenn Sie Stromfresser wie Waschmaschine und Spülmaschine tagsüber betätigen. Immer dann, wenn das Sonnenlicht für neuen Strom sorgt. Möglicherweise können Sie sich so den teuren Batteriespeicher sparen.

Eine vollständige Berechnung der Wirtschaftlichkeit der Photovoltaikanlage ist nicht trivial. Viele Faktoren sind zu berücksichtigen.
Für überschüssigen Strom, den Sie ins öffentliche Netz einspeisen, erhalten sie eine Einspeisevergütung. Sie trägt zwar zur Finanzierung der Anlage bei. Die Vergütung liegt deutlich unter den aktuellen Strompreisen der Versorger (derzeit 27 bis 47 Cent pro Kilowattstunde). Beispielsweise sind es seit dem 1. Februar 2025 für Neuanlagen bis 10 kWp* 7,94 Cent pro Kilowattstunde. Bei größeren Anlagen sind es aktuell 6,88 Cent pro Kilowattstunde, die vergütet werden.
Eine höhere Vergütung (bis 12,6 Cent pro kWh) ist möglich, wenn Sie den Strom vollständig ins Stromnetz einspeisen. Allerdings reduziert die Photovoltaikanlage dann nicht Ihre Stromrechnung. Die Anlage kann sich daher schneller rechnen, wenn mehr Solarstrom selbst genutzt wird. Experten gehen davon aus, dass sich eine Photovoltaikanlage auf dem Dach innerhalb von zehn bis fünfzehn Jahren amortisiert.
Wie viel Geld Sie für den eingespeisten Solarstrom erhalten, hängt vom Zeitpunkt ab, an dem Ihre Anlage in Betrieb geht. Für alle neuen Anlagen, die bis Ende Juli 2025 starten, gilt der aktuelle Vergütungssatz laut EEG 2023 – er bleibt bis dahin stabil. Ab dem 1. August 2025 sinkt die Vergütung für neue Anlagen um ein Prozent. Einmal festgelegt, wird dieser Satz 20 Jahre lang gezahlt.
*Die elektrische Leistung einer Photovoltaik-Anlage wird in Kilowattpeak (kWp) angegeben. Das ist die maximale Leistung der Solarmodule.
Photovoltaikanlagen für Eigenverbrauch oder Volleinspeisung – die Vergütungssätze
Die Vergütungssätze gelten für Betreiber von Photovoltaikanlagen von 10 bis 40 kWp. Sie beziehen sich auf Neuanlagen zwischen dem 1. Februar und 31. Juli 2025.
| Eigenverbrauch mit Teileinspeisung | Volleinspeisung | ||
|---|---|---|---|
| Vergütung pro Kilowattstunde (kWh) | Bis zu zehn Kilowatt | 7,94 Cent 7,87 Cent ab August 2025 7,08 Cent ab Februar 2026 | 12,60 Cent 12,48 Cent ab August 2025 11,23 Cent ab Februar 2026 |
| Danach bis 40 Kilowatt | 6,88 Cent 6,81 Cent ab August 2025 6,13 Cent ab Februar 2026 | 10,56 Cent 10,46 Cent ab August 2025 9,41 Cent ab Februar 2026 | |
| Laufzeit ab Jahr der Inbetriebnahme | 20 Jahre | 20 Jahre | |
Wer darf eine Photovoltaik-Anlage installieren?

Photovoltaikanlage zur Eigennutzung oder Volleinspeisung bedürfen der Zustimmung aller Miteigentümer.
Photovoltaikanlagen können Privatpersonen und Unternehmen anschaffen. Ob sie diese jedoch anbringen dürfen, hängt von den Eigentumsverhältnissen ab. Mieter müssen ihre Vermieter um Erlaubnis fragen. Eigentümer in Mehrparteienhäusern benötigen die Zustimmung der Miteigentümer. Denn PV-Anlagen auf dem Dach, im Garten oder an der Balkonbrüstung bedeuten eine optische Veränderung des äußeren Erscheinungsbildes, dem Gemeinschaftseigentum. Diese geht laut den meisten Teilungserklärungen jeden Eigentümer etwas an.
Solarmodule dürfen grundsätzlich in Eigenregie montiert werden. Fachleute raten jedoch davon ab – vor allem, weil Hersteller ihre Garantien an eine fachgerechte Installation knüpfen. Den Anschluss an die Hausinstallation muss ein Elektrofachbetrieb übernehmen; den Netzanschluss muss ein vom Energieversorger zertifizierter Betrieb durchführen.
Hinzu kommt, dass Photovoltaikanlagen, die an oder auf Gebäuden installiert werden, technische und (bau-)rechtliche Vorgaben wie etwa Brandschutz einhalten müssen. Viele Hersteller knüpfen ihre Garantien an eine fachgerechte Montage. Um diese im Zweifelsfall nachzuweisen, sollte die Anlage durch Profis installiert werden. Den Anschluss an die Hauselektrik und ans Stromnetz muss ohnehin der Elektrofachbetrieb durchführen. Die Photovoltaikanlage, auch Erzeugungsanlage genannt, muss zudem bei Ihrem örtlichen Netzbetreiber angemeldet werden. Dieser führt eine sogenannte Netzverträglichkeitsprüfung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben des aktuellen Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG ) durch.
Welche Voraussetzungen sind für PV-Anlagen auf dem Dach ideal?
Von der Statik her eignen sich die meisten deutschen Dächer, um eine Photovoltaikanlage zu stützen. Sowohl auf schrägen Dachflächen als auch auf Flachdächern können Solarmodule dauerhaft installiert werden. Idealerweise hat das Schrägdach eine Neigung von 30 Prozent. Auf Flachdächern erhalten die Module eine Stütze, so dass sie mit optimaler Neigung ausgerichtet sind. Geringere Neigungen (unter 25 Grad) und stärkere (über 50) können den Stromertrag um bis zu zehn Prozent mindern.
Eine Südausrichtung ist ideal, denn hier scheint am längsten die Sonne auf das Dach. Eine Ausrichtung nach Südost oder Südwest ist auch geeignet. Sie schmälert den Ertrag minimal. Bei einer Ausrichtung nach Osten oder Westen verringert sich der Stromertrag um etwa zehn bis 20 Prozent.
Wichtig ist, dass die Sonne möglichst ungehindert auf die Dachflächen strahlen kann. Verschattungen durch Bäume oder benachbarte Bäume können sich nachteilig auswirken.
Ist die Ausrichtung der Photovoltaikanlage nicht optimal? Sogenannte Leistungsoptimierer können bei Verschattungen und reduzierter Sonneneinstrahlung die Leistung der Photovoltaikanlage deutlich steigern. Sie überwachen und steuern die Photovoltaikanlage auf Modulebene.
Für die Installation von einem kWp-Anlagenleistung werden sechs bis sieben Quadratmeter Fläche benötigt. Der Stromertrag der Anlage schwankt mit der Sonneneinstrahlung und den Jahreszeiten. Lassen Sie sich am besten von einem Fachbetrieb beraten.
Was kostet eine Photovoltaikanlage?
Die reinen Anschaffungskosten kleiner Solaranlagen ohne Speicher – etwa von 5 bis 10 Kilowattpeak (kWp) – liegen zwischen 1.000 und 1.800 Euro pro kWp. Größere Anlagen ab 20 kWp kosten 900 bis 1.500 Euro pro kWp. Sie rentieren sich schneller. Hinzu kommen Montagekosten, die einen erheblichen Anteil an der Gesamtinvestition ausmachen.
Wer einen Stromspeicher einplant, muss mit höheren Gesamtkosten rechnen. Die Preise für Speicher liegen netto meist zwischen 400 und 800 Euro pro Kilowattstunde (kWh) Speicherkapazität. Für eine typische 10-kWp-Anlage mit einem 10-kWh-Speicher summieren sich die Gesamtkosten inklusive Installation schnell auf 18.000 bis 35.000 Euro.
Günstige Komplettpakete mit Speicher starten zwar bei rund 11.000 Euro, betreffen aber kleinere Systeme mit begrenzter Kapazität.
Beim Kauf kleinerer Photovoltaikanlagen bis 30 kWp für ein Wohnhaus fällt keine Umsatzsteuer mehr an. Diese Steuerbefreiung gilt auch für dazugehörige Komponenten wie Stromspeicher und Wechselrichter. Auch für die Montage fällt keine Umsatzsteuer mehr an. Ebenfalls begünstigt ist der Austausch einzelner Komponenten, bei Anlagen, die vor 2023 in Betrieb gegangen sind.
Der Maßstab für den Umfang der PV-Anlage sollte Ihr Budget und die verfügbare Fläche sein, nicht der derzeitige Stromverbrauch. Denken Sie auch an die Zukunft: Etwa, wenn Sie den selbst erzeugten Strom später einmal zur Wärmegewinnung mittels Wärmepumpe nutzen wollen oder ein Elektroauto damit betreiben.
Welche Förderungen für Photovoltaikanlagen gibt es?
Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW ) unterstützt den Kauf und die Installation von Photovoltaikanlagen mit zinsgünstigen Darlehen. Vorausgesetzt, dass ein Teil des produzierten Stroms ins Netz eingespeist wird. Gefördert wird zudem der Einbau von Batteriespeichern. Auch in einigen Kommunen und Bundesländern gibt es Zuschüsse für Photovoltaikanlagen und Batteriespeicher. Einen Überblick der aktuellen Photovoltaikförderungen haben wir hier zusammengestellt.
KfW-Förderkredit 270: Erneuerbare Energien – Standard
Die KfW Förderung von Photovoltaikanlagen mit dem Kredit "Erneuerbare Energien – Standard (270)" in Kürze:
- Kredit ab 3,76 % effektivem Jahreszins
- Für Anlagen zur Erzeugung von Strom und Wärme, für Netze und Speicher
- Für Photovoltaik, Wasser, Wind, Biogas und vieles mehr
- Für Privatpersonen, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen
Welche gesetzlichen Vorgaben sind einzuhalten?
Der Weg zur eigenen Photovoltaikanlage ist mit einigen Formalitäten verbunden:
1 Baugenehmigung prüfen
Wenn Sie sich mit den Miteigentümern auf einen Anlagentyp geeinigt haben, sollten Sie vor Anschaffung und Installation die baurechtlichen Voraussetzungen prüfen. In einigen Bundesländern ist eine Baugenehmigung nötig oder es müssen Vorschriften aus dem Denkmalschutz beachtet werden. Bei Ihrer Stadt- und der Gemeindeverwaltung beziehungsweise dem zuständigen Bauamt erhalten Sie die nötigen Informationen.
2 Anmeldung beim Netzbetreiber
Jede Photovoltaikanlage (außer Inselanlagen und Steckersolar-Geräte) muss beim lokalen Netzbetreiber angemeldet werden. Denn dieser regelt den Anschluss an das Stromnetz. Er nimmt außerdem den überschüssigen Strom ab und vergütet jede eingespeiste Kilowattstunde nach den Vergütungssätzen des EEG. An ihn müssen Sie bestimmte Daten einmalig und jährlich melden. Viele Netzbetreiber schlagen den Abschluss eines Einspeisevertrags vor. Dies ist für Sie aber nicht verpflichtend.
3 Anmeldung im Marktstammdatenregister
Ihre Photovoltaikanlage sowie den möglichen Batteriespeicher müssen Sie online bei der Bundesnetzagentur ins Marktstammdatenregister eintragen. Meldepflichtig sind die Inbetriebnahme, die Stilllegung, technische Änderungen und auch ein Betreiberwechsel. Für Steckersolar-Geräte gibt es seit April 2024 ein vereinfachtes Anmeldeformular.
4 Zusätzlicher Zähler notwendig
Bei einer Anlage zur Eigenversorgung bis 30 Kilowatt muss der bisherige Bezugszähler durch einen Zweirichtungszähler ersetzt werden. Dieser misst sowohl den Stromertrag als auch die Überschusseinspeisung aus der Photovoltaikanlage. Bei einer Anlage zur Volleinspeisung ist zusätzlich zum vorhandenen Bezugszähler ein weiterer Zähler für die Einspeisung notwendig.
Keine Gewerbeanmeldung für kleine Anlagen
Wer eine Solaranlage betreibt und Strom ins öffentliche Netz einspeist, ist gewerblich tätig. Allerdings sind seit 2023 Betreiber von PV-Anlagen mit einer Leistung unter 30 kWp von der Gewerbesteuer befreit – bis dahin galt die Höchstgrenze von 10 kWp.
5 Steuererklärung kann entfallen
Früher mussten diese Gewinne über eine Einnahmen-Überschuss-Rechnung in der Steuererklärung erfasst werden. Seit dem 1. Januar 2022 ist das deutlich einfacher: Für kleinere PV-Anlagen entfällt die Einkommensteuer auf Einnahmen aus dem Verkauf von Solarstrom und aus der privaten Nutzung. Die Regelung gilt für neue und bestehende Anlagen mit einer installierten Leistung bis 30 Kilowatt auf, an oder neben Einfamilienhäusern. Bei Mehrfamilienhäusern liegt die Grenze bei 15 Kilowatt pro Wohneinheit, bei Inbetriebnahme ab Januar 2025 einheitlich bei bis zu 30 kWp. Damit entfällt auch die Pflicht zur Abgabe einer Einnahmen-Überschuss-Rechnung – allerdings können die Anlagen nicht mehr steuerlich abgeschrieben werden.
Trotz der Steuerfreiheit gilt: Wer Strom ins Netz einspeist, wird steuerlich als Unternehmer eingestuft. Deshalb muss eine solche Anlage innerhalb eines Monats nach Inbetriebnahme beim Finanzamt gemeldet werden. In der Praxis wird diese Pflicht jedoch oft ausgesetzt – sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Dazu zählen: Die PV-Anlage ist steuerfrei, überschreitet die 30-Kilowatt-Grenze nicht und fällt unter die Kleinunternehmerregelung.
Wenn Sie eine größere Anlage besitzen, aber wenig Gewinn erwirtschaften, können Sie die Photovoltaikanlage beim Finanzamt als steuerrechtliche Liebhaberei einstufen lassen. Sie sind dann von der Steuererklärung für Ihre Anlage befreit. Die Kosten für Arbeitsleistungen bei der Montage und Installation können Sie aber weiterhin als Handwerkerleistungen von der Einkommensteuer absetzen.
Die Einnahmen aus Photovoltaikanlagen sind zudem steuerbefreit, wenn der erzeugte Strom vollständig in das öffentliche Stromnetz eingespeist wird.
Solaranlagen sollten mindestens über die Wohngebäudeversicherung gegen Schäden durch Sturm, Hagel, Blitz oder Brand abgesichert sein. Bei größeren oder besonders kostenintensiven Anlagen – etwa wenn ein Kredit zur Finanzierung genutzt wird – kann eine eigene Photovoltaikversicherung sinnvoll sein. Sie deckt meist auch Ertragsausfälle, Diebstahl oder technische Defekte ab. Zwar ist sie teurer als der Basisschutz über die Gebäudeversicherung, wird aber teils bereits für die ersten ein bis drei Jahre im Kaufpreis der Anlage mit angeboten.
Solarpaket I – Das ist neu für Betreiber von PV-Anlagen
Seit Mai 2024 gilt das sogenannte „Solarpaket I“, verabschiedet von der vorherigen Bundesregierung. Die Neuregelungen betreffen insbesondere Photovoltaik-Anlagen, die neu in Betrieb genommen werden.
1Stecker-Solargeräte zählen nicht mehr zur Hauptanlage
Stecker-Solargeräte werden unabhängig von bestehenden Dachanlagen betrachtet. Ihre Leistung wird nicht mehr zur Gesamtleistung dazugerechnet – die Gefahr, dadurch Fördergrenzen zu überschreiten, entfällt.
2Modultausch ohne Verlust der Einspeisevergütung
Der Austausch alter Module ist nun auch möglich, wenn die bisherigen Module noch funktionsfähig sind. Die alte Einspeisevergütung bleibt für den bisherigen Anlagenteil erhalten. Nur der Zuwachs durch stärkere Module wird nach dem aktuellen Vergütungssatz abgerechnet.
3Netzanfragen müssen schneller beantwortet werden
Netzbetreiber haben nur noch vier Wochen Zeit, um eine Netzanfrage für Anlagen bis 30 kWp zu beantworten. Reagieren sie nicht fristgerecht, gilt die Anfrage automatisch als genehmigt.
4Mehr Spielraum beim Mieterstrom
Neben Wohnhäusern dürfen nun auch Gewerbegebäude und Nebenanlagen (zum Beispiel Garagen) für geförderten Mieterstrom genutzt werden – sofern der Strom ohne Durchleitung durch ein öffentliches Netz direkt an Mieter oder WEG weitergegeben wird.
5Vereinfachung bei Volleinspeisung
Für Volleinspeise-Anlagen entfällt künftig die Pflicht, einen separaten Stromliefervertrag für den Eigenverbrauch des Wechselrichters abzuschließen. Die wenigen Kilowattstunden werden einfach über die Hausstromrechnung abgerechnet – separate Anschlüsse und Grundgebühren entfallen.
Was die aktuelle Bundesregierung plant
Im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD finden sich erste Leitlinien für die Weiterentwicklung der Solarförderung:
- Förderung von PV-Anlagen mit Speichern soll systemdienlich erfolgen – mit Anreizen für netzfreundliches Verhalten.
- Bestandsanlagen sollen stärker eingebunden werden, etwa durch direkte Einspeisung zu Marktpreisen oder durch neue Regeln bei negativen Börsenstrompreisen (Nullvergütung).
- Verfahren zur Anmeldung von Anlagen sollen digitalisiert und vereinheitlicht werden.
Wie diese Absichten konkret aussehen, wird sich in den nächsten Monaten zeigen.
Solarpflicht für Neubauten und Sanierungen – das planen die Länder
Die sogenannte Solarpflicht verpflichtet Bauherren unter bestimmten Voraussetzungen zur Installation von Solaranlagen – meist auf Dächern. In der Regel gilt die Pflicht für Neubauten und bei umfassenden Dachsanierungen. Die genaue Ausgestaltung ist Ländersache – und entsprechend unterschiedlich.
Wo die Solarpflicht aktuell gilt
Stand: Mai 2025
- Baden-Württemberg: Solarpflicht für Neubauten (Wohn- und Nichtwohngebäude), bei umfassenden Dachsanierungen und neuen Parkplätze mit mehr als 35 Stellplätzen.
- Bayern: Solarpflicht für neue Gewerbe- und Industriegebäude sowie Wohngebäude und Dachsanierungen.
- Berlin: Solarpflicht für Neubauten und bei größeren Dachsanierungen.
- Brandenburg: Solarpflicht für neue Fabriken und Bürogebäude sowie bei vollständiger Dachsanierung für diese Gebäude.
- Bremen: Solarpflicht für Neubauten und bei Dachsanierungen.
- Hamburg: Solarpflicht für Neubauten und Bestandsgebäude, wenn am Dach wesentliche Umbauten vorgenommen werden.
- Hessen: Solarpflicht nur für landeseigene Gebäude.
- Niedersachsen: Solarpflicht für gewerblich genutzte Gebäude und ab 2025 auch für neue Wohngebäude.
- Nordrhein-Westfalen: Solarpflicht für neue Nichtwohngebäude, große Parkplätze und ab 2025 auch für neue Wohngebäude. Ab 2026 für Sanierungen größerer Dächer.
- Rheinland-Pfalz: „PV-ready“-Pflicht für Wohngebäude. Die Dächer müssen so vorbereitet sein, dass eine Solaranlage einfach installiert werden kann. Solarpflicht für Nichtwohngebäude und Parkplätze.
- Schleswig-Holstein: Solarpflicht nur für Nichtwohngebäude.
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen haben bislang keine Solarpflicht.
Service: Linksammlung weitere Informationen zu den technischen und gesetzlichen Regelungen von Photovoltaikanlagen:

Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Tipps & Aktuelles – Versand wöchentlich
Ausdruck: 07.07.2025
© IMMO.info gemeinnützige GmbH